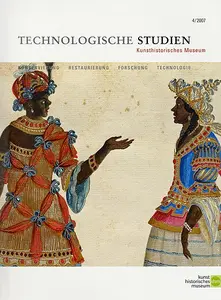Im Zuge der Ausstellung Bilder aus dem Wüstensand 1998/99 im Kunsthistorischen Museum und im Zusammenhang mit der geplanten Neuaufstellung der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums wurden die antiken Mumienporträts aus der Oase Fayum in Ägypten hinsichtlich ihres Erhaltungszustandes überprüft und teilweise konserviert bzw. restauriert. Von den insgesamt zehn erhaltenen Porträts sind sechs in Temperamalerei und vier in enkaustischer Technik, d. h. unter Verwendung von Wachs als Bindemittel, ausgeführt. Vor allem die Temperagemälde zeigten einen durch klimatische Schwankungen verursachten deutlichen Abbau des organischen Bindemittels und somit infolge der verringerten Haftung zum Holzträger aufstehende Malschichten bzw. Malschichtverluste sowie eine pulvrige Oberfläche. Darüber hinaus waren Malschichtverluste durch das Entfernen der zur Montage auf den Mumien verwendeten Leinenstreifen, Sprünge in den Holztafeln sowie Flecken und Verfärbungen durch Materialien aus früheren restauratorischen Eingriffen an den Objekten zu beobachten.
Restaurierung von Mumienporträts: Konservatorische Maßnahmen und Analyse historischer Klebematerialien
Die Restaurierung umfasste die Festigung loser Malschichtbereiche, die Entfernung störend wirkender früherer Restauriermaterialien, das (Neu-)Verkleben von Rissen in den Holzträgern, eine trockene Oberflächenreinigung an den Temperabildern und eine Reinigung mit destilliertem Wasser an den enkaustischen Gemälden sowie die Neumontage der Objekte in einem eigens angefertigten Trägersystem, welches das Auftreten von Spannungen in den Holzträgern in Zukunft minimieren soll.
Parallel zur konservatorischen bzw. restauratorischen Behandlung wurden Untersuchungen in Hinblick auf die Zusammensetzung des zur Montage der Mumienporträts verwendeten Klebematerials an der Rückseite der Porträts vorgenommen. Erste Voruntersuchungen mittels optischer Mikroskopie, mikrochemischer Tests und Infrarot-Mikroskopie ergaben die Verwendung einer Materialmischung aus mehreren Komponenten, konnten jedoch lediglich eine Harzkomponente nachweisen.
Durch den zusätzlichen Einsatz von Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) in weiterführenden Analysen war es möglich, die Zusammensetzung der Klebemassen weiter zu präzisieren. Es handelt sich dabei hauptsächlich um stark oxidiertes Kiefernharz, das mit einem Pflanzenöl unbekannter Herkunft vermischt wurde. An einer Probe konnte darüber hinaus auch ein Zusatz von Bienenwachs nachgewiesen werden.