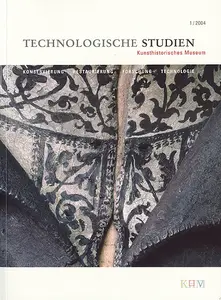Hans Holbein d. J. malte das Porträt von Jane Seymour (um 1509 – 1537), der dritten Gemahlin Heinrichs VIII., um 1536/37 während seines zweiten Aufenthaltes in England. Das Bild wird erstmals 1720 in der kaiserlichen Galerie erwähnt. Ein Ausstellungsvorhaben im Mauritshuis in Den Haag 2003 war der Anlass für die Restaurierung des Bildes und bot Gelegenheit, den Erhaltungszustand und maltechnischen Aufbau des Gemäldes näher zu untersuchen.
Restaurierung eines Holbein-Gemäldes: Farbwirkung und Schutzmaßnahmen
Das Gemälde ist auf einer Eichenholztafel gemalt, die vermutlich im frühen 19. Jahrhundert parkettiert wurde. Den Bildaufbau hat Holbein gezielt durch den Einsatz lokaler, grauer Untermalungen vorbereitet, die er über einer weißen Kreidegrundierung und einer lachsfarbenen Imprimitur auftrug. Für den charakteristischen blauen oder blau-grünen Hintergrund der Porträts aus dieser Schaffensperiode verwendete er als Pigmente meist Azurit oder Smalte. Vor allem letztere ist wenig alterungsbeständig und neigt zu Farbveränderungen – Probleme, die an Holbein Porträts häufig zu sehen sind. Im vorliegenden Fall erwies sich der Erhaltungszustand der blauen, smaltehältigen Malschicht überwiegend als außergewöhnlich gut, wenn auch anzunehmen ist, dass der Farbton ursprünglich noch intensiver war. Ein möglicher Grund dafür ist der Umstand, dass der Hintergrund für einen unbekannten Zeitraum durch eine flächige Übermalung geschützt war, die anlässlich einer Restaurierung 1936/37 abgenommen wurde.
Der unbefriedigende ästhetische Zustand des Gemäldes, bedingt durch gegilbte und teilweise vergraute Firnisschichten, machte eine Reinigung notwendig. Die ganzflächige Firnisreduzierung, bei der bestehende Unregelmäßigkeiten soweit wie möglich ausgeglichen wurden, führte insgesamt zu einer Verbesserung der farblichen Wirkung des Gemäldes. Die großflächige und farblich inadäquate Übermalung im Bereich des Schlagschattens wurde entfernt, was sich positiv auf das räumliche Verhältnis zwischen Figur und Hintergrund auswirkte.
Bei der nachfolgenden Retusche wurden vor allem die tiefen Bereibungen der Malschicht im Hintergrund links farblich angeglichen, womit eine Reduzierung der störenden Fleckigkeit erreicht wurde. Nach den einzelnen Arbeitsschritten erfolgte jeweils ein Auftrag von Mastixfirnis. Um dem Tafelbild ein möglichst stabiles Raumklima zu bieten, wurde es nach Abschluss der Restaurierung in einer in den Zierrahmen integrierten Klimavitrine montiert.